Nur eine Abfrage ans Publikum
 |
| Publikumszettel für das Zettelspiel |
Immer wieder entsteht die Diskussion unter Kollegen des Improtheaters, ob Publikum schnell unzufrieden ist, wenn es nur wenige oder nur am Anfang einer Langform Abfragen gibt. Man lässt sich zu Beginn ein Setting und Charaktere von Zuschauern ausstatten und los geht's. Was dann folgt ist eine Langform, keine Theatersportspiele und oft eine zusammenhängende Geschichte, die sich über zwei Hälften erstreckt. Ich spiele mit dem Improtheater Paternoster auch eine solche Langform, nur fragen die Spieler relativ häufig zwischen durch. Auch wegen der "Beschwerde", man würde sonst zu wenig fragen oder viel weniger, als in einer Gameshow. Also würde das Publikum weniger eine tragendene und beeinflussende Rolle haben. Aus dieser Unsicherheit wird also oft an Stellen das Publikum gefragt, wo die Story gar keine Unterbrechung verträgt. "Soll er sterben oder nicht? etc.". Wenn Abfragen dann in emotionalen Höhepunkten passieren, werde ich völlig aus der Emotion und Story gerissen, nur dafür, dass das Publikum abstimmen kann und noch mal bestätigt bekommt, dass es im Improtheater sitzt. Ich finde diese Abfragerei in der Langform in der Art oft unnötig. Es zerreißt einen schönen Moment und man kommt nicht so schnell wieder ein. Ganz abgesehen davon, dass ich die Musik unterbrechen muss und es wie eine Werbeunterbrechung im Fernsehen wirkt.
Die Frage ist also: "Wieviel Abfrage ist nötig? Wann ist das Publikum zufrieden?" Ich denke, dass das von Zuschauer zu Zuschauer unterschiedlich ist. Es kommt auf die Erwartungen an, die im Vorhinein geschürt werden. Ganz konkret für diese eine Show und allgemein im Improvisationstheater. Denn alle stützen sich bei der Werbung drauf, dass das Publikum der Entscheider ist und Ideen geben kann. Dabei sollte der Fokus doch darauf liegen, dass das Ganze improvisiert ist und aus dem Moment heraus entsteht. Allein das müsste die Menschen doch ins Theater bewegen und staunen lassen. Es geht doch um die Lust am Spontanen, nicht um die Macht, die ich als Publikum dann auch noch in der Show mit meinen Eingaben habe, neben dem Eintrittsgeld, das auch eine gewisse Macht ausübt auf die ausführenden Personen. Genügt es nicht am Anfang einen Startpunkt zu setzen und dann eine Geschichte zu sehen, die gut gespielt ist und meine Erwartungen an eine Geschichte, nicht ans "Mitbestimmen" erfüllt. Die Crumbs aus Kanada machen das und sammeln nur am Anfang zwei, drei Begriffe. Mehr nicht. Dann folgt ein toller Improabend mit mehreren Geschichten, die nur auf die Begriffe des Anfangs beruhen. Keine Abfragen zwischen durch, keine lästigen Unterbrechungen. Und dennoch finden es alle toll. Weil es eben gut gespielt ist!
 |
| Hear and Now Concert Improv www.hear-and-now.com |
Würde ich das auf die Musik übertragen, merkt man schnell, wie albern eigentlich diese Abfragerei ist und vor allem, das sich darauf stützen und damit zu werben. Es fehlt schlichtweg das Selbstbewusstsein in dieser Theaterform. Wenn ich mein improvisiertes Konzert jedes Mal an einer dramatischen Stelle unterbrechen würde und fragte, wie soll ich weiterspielen, glaube ich kaum, dass irgendjemand bis zum Schluss im Konzert bleiben würde. Nicht, wenn es ihm um die Musik geht, statt sein Ego zu befriedigen und als Zuschauer Teil der Show zu werden. Auch Abfragen am Anfang habe ich meist vermieden. Die Zuschauer wurden oft aufgeklärt, dass alles, was folgt, improvisiert ist und das mussten sie mir dann auch glauben. Taten sie auch. Wenn nicht, dann war es ein großes Kompliment für mich. Doch es hat sich nie jemand beschwert, dass er nicht "Fis-Dur!", "Forte! Forte!" oder "Jetzt ritardando!" rufen durfte.
Vorpubertär und niveaulos
Als ich letztens in der Pause einer Improshow eine Zuschauerin fragte, ob sie auch gerade in der ersten Hälfte der Show war bekam ich nur zu hören
"Ein Freund riet mir, erst zur zweiten Hälfte reinzugehen. Es soll sehr vorpubertär und niveaulos sein."
Sie war bisher noch nie in einer Improshow und geht mit diesen Vorbehalten hinein. Sicher kann man meinen, sie solle sich selbst eine Meinung bilden. Aber ich finde es bezeichnend, wenn solche Meinungen über Improshows herrschen. Sowas trägt sich schneller weiter, als die ganze Improszene nur bis auf Los runter zählen kann. Es ist also nach wie vor die Qualitätsdiskussion und wie das Ganze nach außen wirkt. In diesem Fall waren die beiden Gruppen wirklich nicht sehr erfahren, aber dennoch fand ich die Show nicht vorpubertär oder niveaulos. Da habe ich in Berlin schon Gruppen gesehen, auf die dieses Prädikat auch nach 10 Jahren zutreffen würde, Wir haben aber ein Qualitätsproblem. Und das liegt eben an der Niedrigschwelligkeit des Improvisationstheaters. Es lässt sich schnell auf die Bühne gehen und ein paar Games spielen nach ein, zwei Workshops. Schnell nennt man sich Schauspieler und hat eine hübsche Website mit tollen Werbeflyern gebastelt. Wie man das Problem lösen kann? Ich weiß es nicht. Es sollte ja auch keine Prüfung dafür geben. Garantien, dass diese oder jene Improgruppe auf jeden Fall höchste Qualität bietet, gibt es nie. Dafür ist es eben improvisiert und auch routinierte Gruppen können schlechte Shows haben, pubertär sein oder was auch immer. Mein guter Freund Thomas meinte dazu nur:
"Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, gehen Sie doch mal zu Gruppe XY. Auf jeden Fall: Gehen Sie wieder zum Improtheater. Denn jeder Abend, jede Gruppe ist anders."
Ob Zuschauer dann wirklich noch eine zweite Chance verteilen ist fraglich. Aber auch darin hat Thomas Recht: Man schaut ja nicht nur eine Sendung im Fernsehen und sagt, man hätte dieses Fernsehen mal ausprobiert. Es hat mir nicht gefallen und deshalb guck ich nie wieder Fernsehen. Da ist was Wahres dran!












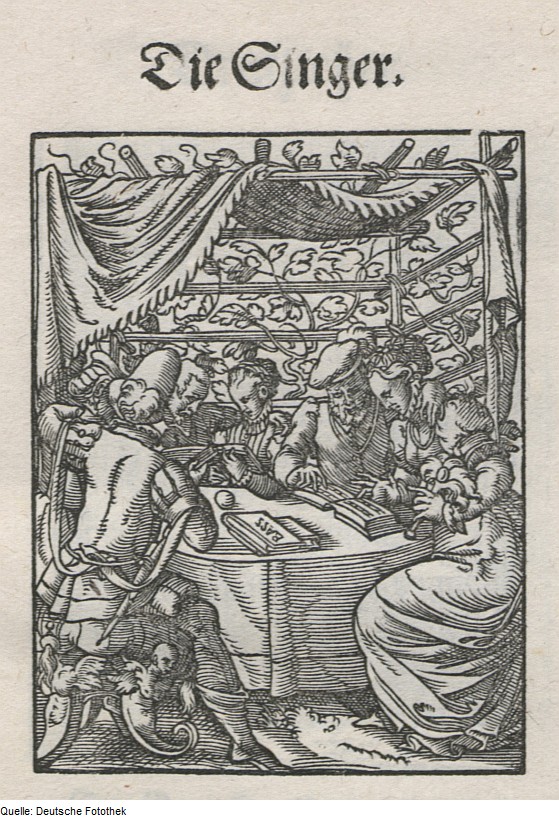



.jpg)
_(2178353269).jpg/320px-School_children_singing,_Pie_Town,_New_Mexico_(LOC)_(2178353269).jpg)

